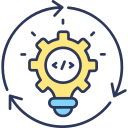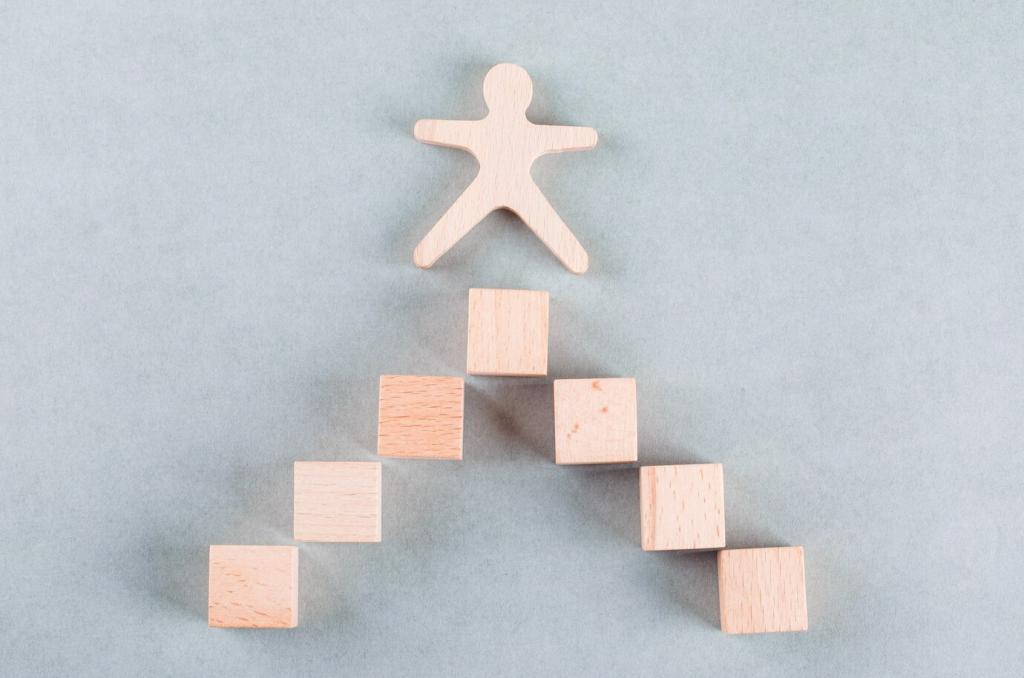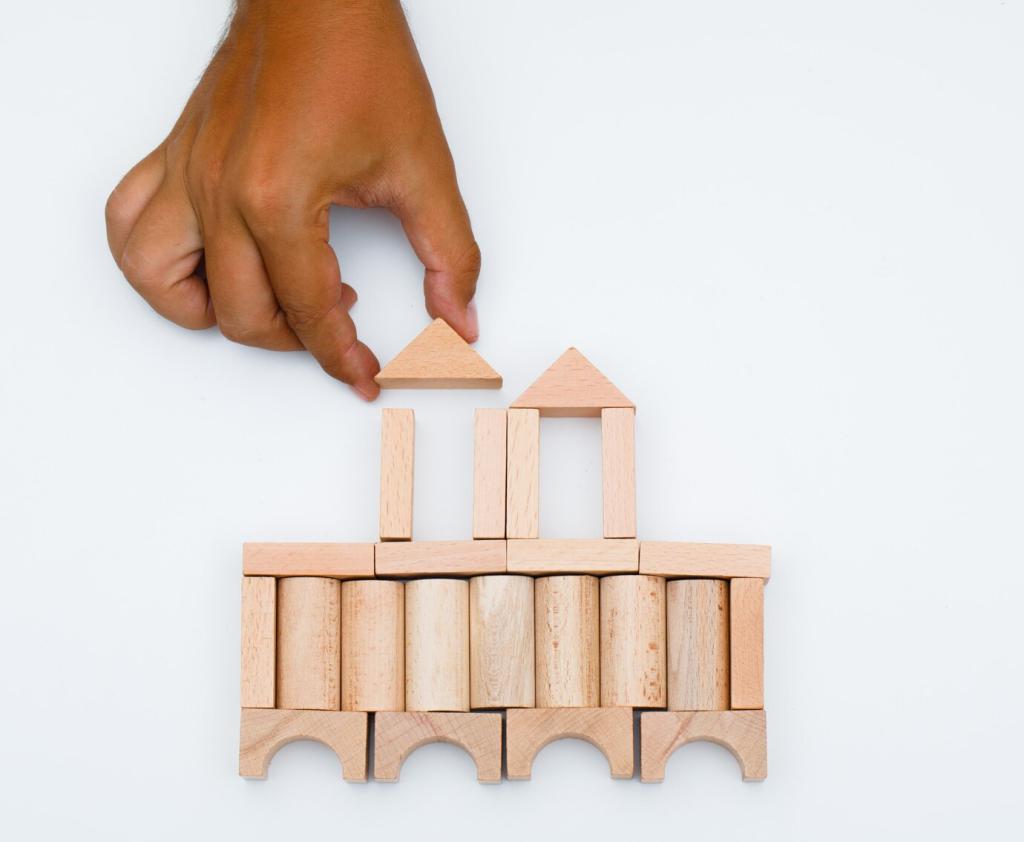Architektur, Integration und Skalierung
API-first, Ereignisarchitekturen und entkoppelte Services verhindern Spaghetti-Integrationen. In einem Projekt wurden Kernservices klassisch entwickelt, während Low-Code Oberflächen und Workflows abbildete. Ergebnis: schnelle Änderungen ohne Kerndomänen zu gefährden. Welche Integrationsmuster haben sich in deinem Umfeld bewährt?
Architektur, Integration und Skalierung
Low-Code skaliert gut, solange man Plattform-Grenzen, Datenbankzugriffe und Caching berücksichtigt. Rechenintensive Funktionen gehören oft in dedizierte Services. Ein Team verlagerte Berichtsgenerierung in einen Cloud-Worker und halbierte Antwortzeiten. Wie misst du Performance frühzeitig, bevor Nutzer es tun?
Architektur, Integration und Skalierung
Lock-in entsteht, wenn proprietäre Features ohne Exit-Strategie genutzt werden. Abhilfe schaffen offene Standards, exportierbare Artefakte und Trennung von Kernlogik. Dokumentiere Migrationspfade und führe regelmäßige Exit-Tests durch. Teile, wie du Plattformabhängigkeiten bewertest und das Risiko transparent machst.